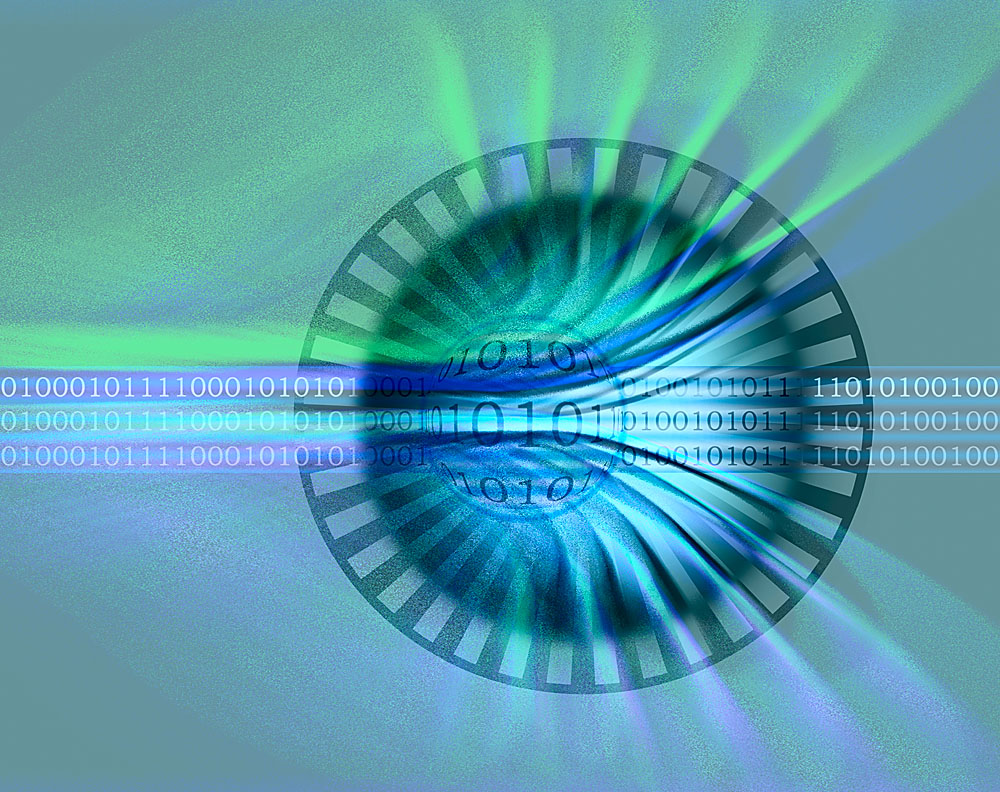Aufgabe 16
A 1: Eine Batterie mit Meerwasser
Vorgaben:
Meerwasser-Batterien sind Batterien, in denen Meerwasser als Elektrolyt dient. Sie werden z. B. als Zubehör von Rettungsbooten eingesetzt. Eine solche Batterie wird erst aktiviert, wenn sie in Meerwasser eingetaucht wird.
Häufig bestehen Meerwasser-Batterien aus einer Aluminium-Elektrode und einem inerten Edelstahlblech. Solange genügend elementarer Sauerstoff im Meerwasser gelöst ist, bildet sich am Edelstahlblech eine Sauerstoff-Elektrode.
Meerwasser-Batterien können auch in sauerstoffarmem Tiefenwasser eingesetzt werden. Sie liefern dann eine niedrigere Spannung. Am Edelstahlblech bildet sich in diesem Fall eine Wasserstoff-Elektrode.
Bei Betrieb der beiden Batterien entstehen
Aluminium(III)-Verbindungen.
Modellversuche sollen die Funktion einer
Meerwasser-Batterie verdeutlichen:
Versuch 1:
Ein
Aluminiumblech und ein Edelstahlblech werden in eine
Kochsalz-Lösung („Modell-Meerwasser“) mit gelöstem
Sauerstoff als Elektrolyt eingetaucht. Zwischen den Blechen
wird ein Motor geschaltet, der schon bei sehr geringer
Spannung betrieben werden kann.
Beobachtungen:
- Der Motor dreht sich für kurze Zeit, die Umdrehungszahl sinkt dabei immer mehr. Nach Umrühren der Kochsalz-Lösung nimmt die Umdrehungszahl wieder zu.
- Tropft man zur Kochsalz-Lösung
Phenolphthalein-Lösung zu, färbt sich die Lösung am
Edelstahlblech nach einiger Zeit rot.
Versuch 2:
In einem weiteren Versuch wird das
Aluminiumblech durch ein Magnesiumblech ersetzt.
Beobachtungen:
- Die Umdrehungszahl des Motors ist größer als in
Versuch 1. An der Oberfläche des
Magnesiumblechs bilden sich ein weißer Feststoff und Gasbläschen. - AAm Magnesiumblech bilden sich auch dann Gasbläschen, wenn der Stromkreis unterbrochen wird.
Aufgaben:
1.1. Zeichnen Sie eine beschriftete Skizze des galvanischen Elements, das in einer Meerwasser-
Batterie mit sauerstoffgesättigtem Meerwasser vorliegt. Stellen Sie die Elektrodenreaktionen
und die Gesamtreaktion für eine solche Meerwasser-Batterie auf.
Berechnen Sie die Spannung dieser Meerwasser-Batterie.
1.2. Erklären Sie die Beobachtungen in den Modellversuchen. Geben Sie für den Modellversuch
mit Magnesiumblech die Gleichungen der an den Elektroden ablaufenden
Reaktionen an.
1.3. Stellen Sie die Elektrodenreaktionen für eine Meerwasser-Batterie mit sauerstoffarmem
Meerwasser auf. Prüfen Sie, ob man eine funktionsfähige Batterie erhält, wenn das
Aluminiumblech der Meerwasser-Batterie durch ein Magnesiumblech ersetzt wird.
Begründen Sie, warum eine Meerwasser-Batterie nicht wieder aufgeladen werden kann.
Zusatzinformation:
Meerwasser enthält etwa 3,5 % Natriumchlorid (NaCl) und weist einen pH-Wert von pH = 8,2 auf.
Eine Elektrode wird als „inert“ bezeichnet, wenn sie
selbst beim Ablaufen der Elektrodenreaktion unverändert
bleibt.
Aluminium ist in einem pH-Bereich von pH = 4 bis
pH = 8,5 durch Ausbildung einer dünnen Hydroxidschicht an
der Metalloberfläche gegen Reaktionen geschützt.
Magnesium ist oberhalb eines pH-Wertes von pH =11,5 durch Ausbildung einer weißen Hydroxidschicht an der Metalloberfläche gegen Reaktionen geschützt.
Umschlagsbereich von Phenolphthalein: pH ≥ 8,5
Elektrochemische Spannungsreihe
Redoxpotentiale in
Meerwasser bei pH = 8,2 in V (bei T = 298 K und p = 101,3
kPa)
| 1 | Mg, OH-/Mg(OH)2 | -2,35 |
| 2 | Al, OH-/Al(OH)3 | -2,00 |
| 3 | H2, OH-/H2O | -0,49 |
| 4 | OH-/O2, H2O | 0,74 |
A 2: Blaulauge zur Bestimmung der Säurekonzentration in Wein
Vorgaben
Von wesentlicher Bedeutung für den Geschmack und die
Haltbarkeit eines Weins ist sein Gehalt an Säuren, der
ebenso wie der Gehalt an Alkohol großen Schwankungen
unterliegt. Im Wein liegen neben Weinsäure und Äpfelsäure,
die den größten Anteil der Gesamtsäure ausmachen, auch
zahlreiche weitere Säuren in kleinen Konzentrationen vor.
Vereinfacht gibt man die Gesamtsäurekonzentration als
Weinsäurekonzentration an. Bei vielen Weinen beträgt die
Massenkonzentration der Gesamtsäure zwischen 7,1 g und 7,9 g
pro Liter Wein. Nach der Gärung kommt es u. a. zur
Umwandlung eines Teils der Äpfelsäure unter Abspaltung von
Kohlenstoffdioxid zu Milchsäure (malolaktische Gärung).
Kohlenstoffdioxid entweicht aus dem Wein. Bei einigen Weinen
leitet man aus Geschmacksgründen die malolaktische Gärung
absichtlich ein.
Bestimmung der Säurekonzentration von
Weißwein
Versuch 1: Titration von Weißwein im Labor
25
mL Wein werden mit Natronlauge (c(NaOH) = 0,2 mol/L) und dem
Indikator Bromthymolblau titriert. Bis zum Äquivalenzpunkt
werden 10,4 mL Natronlauge verbraucht.
Für Winzer sind
Acidometer entwickelt worden, mit denen der Säuregehalt von
Weißwein bestimmt werden kann. Ein Acidometer-Set besteht
aus einem Messzylinder, 250 ml Blaulauge und einem
Tropfverschluss für die Laugenflasche. Blaulauge ist eine
Natronlauge mit c(NaOH) = 0,133 mol/L, die mit einigen
Tropfen Bromthymolblau-Lösung blau gefärbt ist. Im
Messzylinder wird Wein bis zur unteren Markierung (10 mL)
vorgelegt. (Oberhalb dieser Markierung ist eine Messskala
für das zugefügte Volumen angebracht.) Anschließend wird
Blaulauge bis zum Farbumschlag zugetropft, wobei stets gut
gemischt wird und keine Flüssigkeit verloren gehen darf.
Laut Angabe des Acidometer-Herstellers entspricht der
Zahlenwert des beim Farbumschlag abgelesenen Volumens dem
Zahlenwert der Massenkonzentration (in g/L) der Gesamtsäure.
Versuch 2: Überprüfung der Angabe des Acidometer-Herstellers
Es werden 10 mL einer Weinsäure-Lösung der Konzentration
c(Weinsäure) = 0,05 mol/L mit der Blaulauge im Acidometer
titriert. Man benötigt 7,5 mL Blaulauge.
Aufgaben
2.1. Zeichnen Sie einen beschrifteten Versuchsaufbau zur Titration des Weins. Berechnen
Sie die Konzentration der Gesamtsäure der Weinprobe (Versuch 1) unter der vereinfachenden
Annahme, dass nur Weinsäure vorliegt. Vergleichen Sie diese Weinsäurekonzentration
mit den genannten Massenkonzentrationen.
2.2. Erläutern Sie unter Angabe von Reaktionsgleichungen die beim Lösen von Weinsäure
in Wasser ablaufenden Reaktionen anhand der Säure-Base-Theorie von Brönsted.
Ermitteln Sie, welche Auswirkungen die malolaktische Gärung eines Weins auf die
Säurekonzentration und den pH-Wert hat.
2.3. Erläutern Sie die Bestimmung der
Säurekonzentration von Wein mit einem Acidometer. Überprüfen
Sie die Angabe des Herstellers zur Auswertung (Versuch 2).
Vergleichen Sie die Säurebestimmung mittels Acidometer mit
einer üblichen Säure-Base-Titration.
Zusatzinformationen:
Weinsäure und Äpfelsäure sind zweiprotonige Säuren.
Tabelle 1:
| Säure | vereinfachte Formel | pKs-Werte | Masse |
| Weinsäure | HOOC-R1-COOH | pKs1=2,9 pKs2=4,3 | 150 g/mol |
| Äpfelsäure | HOOC-R2-COOH | pKs1=3,5 pKs2=5,1 | 134 g/mol |
| Milchsäure | R3-COOH | pKs=3,9 | 90 g/mol |
Vereinfachend kann angenommen werden, dass die meisten Weine und verdünnte Weinsäure-Lösungen eine Dichte von r = 1,0 g/mL haben.
Indikator Bromthymolblau
Umschlagsbereich pH 6,0 – 7,5 Farbe alkalisch: blau, sauer: gelb
A3: Tartrazin, ein Farbstoff für Süßigkeiten
Vorgaben:
Tartrazin ist ein synthetischer Farbstoff, dessen Absorptionsmaximum bei l = 425 nm liegt.
Tartrazin
Tartrazin-Mpleküle enthalten eine planare Struktureinheit, die sich vom Pyrazol, einem Aromaten, ableitet:
Pyrazol
Ausgangsstoffe für die Tartrazin-Synthese sind Sulfanilsäure, Natriumnitrit (NaNO2) und die Substanz A
Substanz A
Tartrazin wird vor allem als Lebensmittelfarbstoff zur Färbung von Süßwaren, wie z. B. Brausepulver, Gummibärchen, Puddingpulver, und zur Färbung von Arzneimitteln eingesetzt. Tartrazin besitzt allergieauslösende Eigenschaften und steht im Verdacht, ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung) zu verstärken. Seit Juli 2010 müssen Lebensmittel, die Tartrazin enthalten, daher mit dem Warnhinweis „Kann die Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern beeinträchtigen“ gekennzeichnet sein. Ursprünglich wurde Tartrazin zur Färbung von Wolle verwendet. Dabei wurden wässrige Farbstofflösungen eingesetzt. Tartrazin ist gut wasserlöslich, licht- und temperaturbeständig und zudem beständig gegenüber Säuren. Es gilt als waschechter Farbstoff.
Aufgabe:
3.1. Erklären Sie den Zusammenhang von Struktur und Farbigkeit am Beispiel der Struktur
von Tartrazin. Geben Sie mithilfe des Absorptionsmaximums die sichtbare Farbe von
Tartrazin begründet an.
3.2. Nennen Sie die Kriterien für ein aromatisches System und begründen Sie, warum Pyrazol
aromatisch ist. Entwickeln Sie einen Syntheseweg für Tartrazin ausgehend von Sulfanilsäure
und Substanz A anhand von Reaktionsgleichungen.
3.3. Begründen Sie die gute
Wasserlöslichkeit von Tartrazin und beurteilen Sie den
Einsatz von Tartrazin als Wollfarbstoff und als
Lebensmittelfarbstoff.
Zusatzinformationen:
Waschechtheit: Widerstandsfähigkeit gegenüber der Einwirkung von Waschmitteln Lichtechtheit: Widerstandsfähigkeit gegenüber der Einwirkung von Licht (Verblassen)
Sulfanilsäure
Stark vereinfachte schematische Darstellung eines Strukturausschnittes von Wolle
Zusammenhang von absorbierter Strahlung, zugehöriger Spektralfarbe und beobachteter Komplementärfarbe
| Wellenlänge λ in nm | Spektralfarbe | Komplementärfarbe |
|---|---|---|
| 400 - 435 | violrtt | gelbgrün |
| 435 - 480 | blau | gelb |
| 480 -490 | grünblau | orange |
| 490 - 500 | blaugrün | rot |
| 500 - 560 | grün | ourpur |
| 560 - 580 | gelbgrün | violett |
| 580 - 595 | gelb | blau |
| 595 - 605 | ornage | grünblau |
| 605 770 | rot | balugrün |
A 4: High Tech auf der Piste
Vorgabe:
Für den Erfolg bei Skiwettkämpfen ist das verwendete Material von besonderer Bedeutung. Die moderne Ski-Technik greift auf unterschiedliche Konstruktionsarten und verschiedene Kunststoffe zurück. So sind z. B. bei einem Carving-Ski die Gleitfläche und die Skioberfläche Kunststoff-Produkte, während für andere Bauteile im Kern des Skis auch Holz oder Metall genutzt werden können. An die Gleitfläche werden hohe Anforderungen gestellt: Sie muss die Basis für gute Gleiteigenschaften darstellen und gleichzeitig einen geringen Verschleiß aufweisen. Für moderne Skigleitflächen wird beispielsweise eine Mischung aus Polyethen (PE) und Graphit verwendet.
Polyethen-Strukturausschnitt
Zum Ausbessern beschädigter Gleitflächen gibt es PE-Reparaturstreifen im Handel, die z. B. mithilfe eines Bügeleisens geschmolzen und auf die schadhafte Stelle aufgetragen werden können. Für die Skioberflächen benötigt man dekorative und schützende Kunststoff-Folien, die thermoplastisch verarbeitet werden können. Gleichzeitig müssen diese Kunststoff-Produkte im Bereich der Gebrauchstemperaturen elastische Eigenschaften aufweisen, um mechanischen Beanspruchungen standzuhalten, ohne zu reißen. Geeignet sind Kunststoffe auf der Basis von Polyamid-12-Elastomeren (kurz PA-12-E). Dabei handelt es sich um thermoplastische Elastomere. Dies sind Werkstoffe, die elastische Gebrauchseigenschaften aufweisen und bei Erwärmung verformbar sind. Sie sind aus linearen oder wenig verzweigten Makromolekülen aufgebaut, die untereinander aufgrund von zwischenmolekularen Wechselwirkungen weitmaschig vernetzt sind. Zur Herstellung von PA-12-Elastomeren werden in der Industrie PA-12 und Polytetrahydrofuran (PTHF) durch Reaktion mit einer Dicarbonsäure (z. B. Hexandisäure) umgesetzt.
Transparente Kunststoff-Folien aus PA-12-E sind mithilfe
spezieller Druckverfahren hervorragend gestaltbar und
verleihen einem Ski auf diese Weise ein ansprechendes
Design.
Aufgabe:
4.1. Beschreiben Sie mithilfe von Strukturformeln und in Teilschritten eine Reaktion zur
Synthese von Polyethen (PE). Erklären Sie in diesem Zusammenhang das Vorliegen
von Makromolekülen unterschiedlicher Molekülmasse in einem PE-Reparaturstreifen.
Erläutern Sie auf molekularer Ebene die Vorgänge, die bei der Reparatur einer beschädigten
Skigleitfläche ablaufen.
4.2. Vergleichen Sie den strukturellen Aufbau der Makromoleküle von PA-12 und PTHF.
Erläutern Sie mithilfe von Strukturformeln zwischenmolekulare Wechselwirkungen bei
PA-12 und PTHF sowie bei PA-12-E. Erklären Sie, warum PA-12-E thermoplastische
sowie elastische Eigenschaften aufweist und somit zur Herstellung von Schutzfolien für
Skioberflächen geeignet ist.
4.3. Ermitteln Sie einen beispielhaften
Strukturformel-Ausschnitt für PA-12-E. Geben Sie den
Reaktionstyp für die Herstellung von PA-12-Elastomeren
begründet an. Erläutern Sie Möglichkeiten zur Steuerung
dieser Polyreaktion.
Zusatzinformation:
Charakteristischer Strukturausschnitt für PA-12-E:
- [PA-12-Baustein] - [Dicarbonsäure-Baustein]
- [PTHF-Baustein] -
.
. weitmaschig vernetzt
durch zwischenmolekulare Wechselwirkungen
.
- [PA-12-Baustein]
- [Dicarbonsäure-Baustein] - [PTHF-Baustein] -