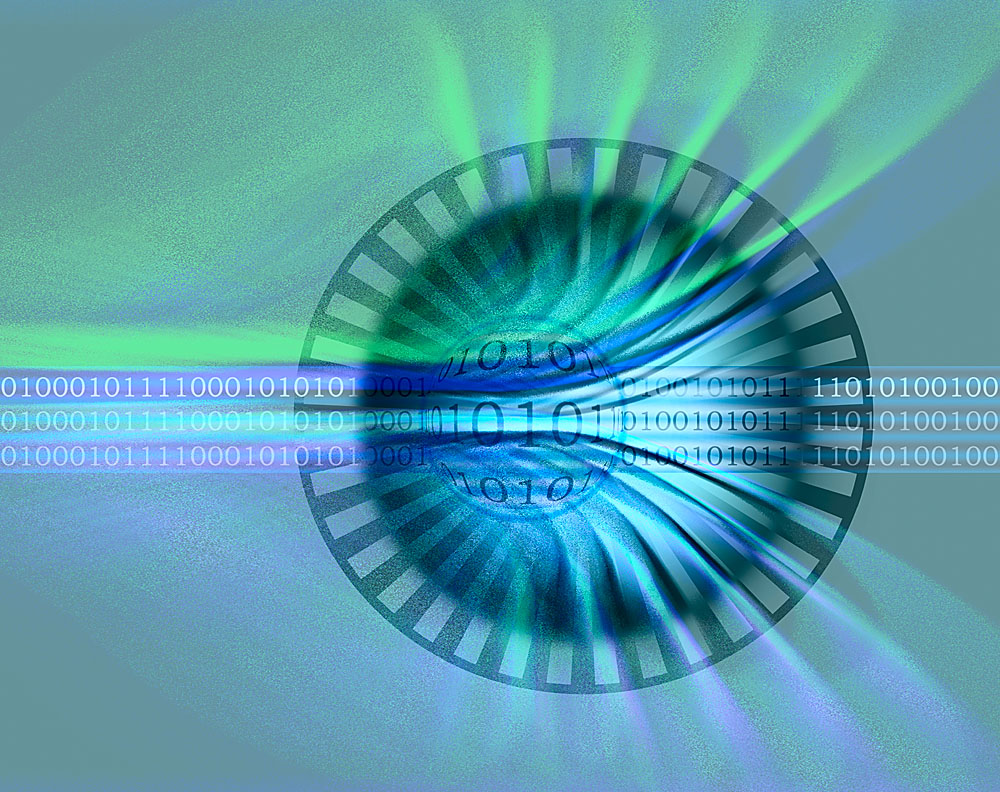Aufgabe 2
Aufgabe I/1:
1. Gegeben sind die folgenden organischen Stickstoffverbindungen:
A: Aminobenzol B: 1-Aminopropan C: D-2-Aminopropansäure D: L-Glutaminsäure
1.1: Zeichnen Sie für die Stoffe A bis D jeweils eine Strukturformel mit bindenden und nichtbindenden Elektronenpaaren.
1.2: Bei Zimmertemperatur ist einer der Stoffe A bzw. C flüssig, der andere fest. Ordnen Sie zu und begründen Sie Ihre Antwort.
1.3: Die Stoffe B bzw. D werden mit destilliertem Wasser versetzt. Formulieren Sie die entsprechenden Reaktionsgleichungen.
1.4: Berechnen Sie den pH-Wert einer wäßrigen Aminobenzollösung der Konzentration c = 0,001 mol*l-1. Ist der pH-Wert einer gleichkonzentrierten wäßrigen Lösung des Stoffes B kleiner oder größer als derjenige der Aminobenzollösung? Begründen Sie Ihre Aussage.
1.5: Eine kleine Stoffportion L-Glutaminsäure wird in Salzsäure mit pH = 1 gelöst und die Lösung durch Zugabe von Natronlauge schrittweise bis auf pH = 13 gebracht. Geben Sie die Strukturformeln für vier der dabei auftretenden Formen von L-Glutaminsäureteilchen an. Kennzeichnen Sie darunter diejenigen, welche bei pH = 1 bzw. bei pH = 13 überwiegen.
2: Im Protein ist die folgende Aminosäuresequenz enthalten: – Cys – Ala –Ala – Lys –
2.1: Beschreiben Sie eine Nachweisreaktion für Proteine.
2.2 Zeichnen Sie die Strukturformel des oben angegebenen Ausschnitts.
Aufgabe I/2:
1 Zu den Pentosen gehören die D-Xylose, die D-Ribose und
die L-Ribose. Dabei unterscheidet sich die D-Xylose von der
D-Ribose durch die Stellung der Hydroxylgruppe am zweiten
asymmetrischen Kohlenstoffatom.
1.1 Zeichnen Sie diese
drei Pentosen in der Fischer-Projektion und erklären Sie die
Begriffe D- und L-Form am Beispiel der Ribose.
1.2 In
wäßriger Lösung liegen Moleküle der D-Xylose sowohl in
6-Ring- Struktur (Pyranoseform) als auch in 5-Ring-Struktur
(Furanoseform) vor. Zeichnen Sie alle möglichen
Ringstrukturen der D-Xylose in Haworth- Projektion und
kennzeichnen Sie darunter die α-Formen.
1.3 Mit D-Xylose
verläuft die Fehlingsche Probe positiv, während die Probe
mit Schiffs-Reagenz (fuchsinschweflige Säure) negativ
ausfällt. Erläutern und begründen Sie diesen Sachverhalt.
2 Vorwiegend aus Cellulose aufgebaute Naturfasern weisen
eine relativ hohe mechanische Festigkeit auf.
2.1
Erklären Sie diese Eigenschaften mit Hilfe des Aufbaus der
Cellulose. Geben Sie dazu einen Ausschnitt aus der
Molekülformel der Cellulose an.
2.2 Cellulose wird
hydrolysiert. Das Hydrolysat enthält unter anderem ein
Disaccharid, die Cellobiose. Zeichnen Sie die Strukturformel
der Cellobiose in Haworth-Projektion und erläutern Sie,
wodurch sich die Cellobiose vom Disaccharid Maltose
unterscheidet.
Aufgabe II/1:
1. Naphthalin ist eine mehrkernige aromatische Kohlenwasserstoffverbindung.
1.1: Erklären Sie mit Hilfe des Orbitalmodells die Bindungsverhältnisse im Naphthalinmolekül. Geben Sie dazu auch eine geeignete Strukturformel an und erläutern Sie den Begriff „mehrkernig“.
1.2: In Tetrachlormethan gelöstes Naphthalin kann wie Benzol mit Brom zur Reaktion gebracht werden, indem man etwas Eisenpulver zugibt und erwärmt. Formulieren Sie hierzu eine Reaktionsgleichung und begründen Sie, warum diese Reaktion im Abzug durchgeführt werden muß.
1.3: Formulieren Sie unter Verwendung von Strukturformeln mit bindenden und nichtbindenden Elektronenpaaren den Reaktionsmechanismus der Bildung von Monobromnaphthalin unter den bei 1.2 genannten Versuchsbedingungen. Geben Sie die Strukturformeln aller möglichen Strukturisomeren des Monobromnaphthalins an.
2. Strukturisomere erhält man ebenfalls bei der Monobromierung von Phenol. Diese Reaktion läuft in wäßriger Lösung auch ohne Zugabe von Eisenpulver spontan ab.
2.1: Formulieren Sie hierzu eine Reaktionsgleichung und erläutern Sie anhand von Strukturformeln den Reaktionsablauf. Begründen Sie, warum die Reaktion ohne Katalysator abläuft.
2.2 Benennen sie alle Strukturisomeren des Monobromphenols und zeichnen Sie dazu die Strukturformeln der Moleküle. Welche dieser Isomeren werden bei dieser Reaktion bevorzugt gebildet? Begründen Sie Ihre Aussage.
Aufgabe II/2:
1- In manchen Allesklebern ist Polyvinylacetat
enthalten. In einer elektrophilen Addition entsteht sein
Monomer Vinylacetat aus Ethin (Acetylen) und Ethansäure.
1.1 Formulieren Sie den
Reaktionsmechanismus für die Bildung des Vinylacetats unter
Verwendung von Strukturformeln mit bindenden und
nichtbindenden Elektronenpaaren.
1.2 Erläutern Sie, wie
aus dem Monomeren Vinylacetat das
Polyvinylacetat-Makromolekül entsteht. Geben Sie den
Reaktionstyp an und skizzieren Sie einen charakteristischen
Ausschnitt aus dem Makromolekül. Wie verhält sich das
Polyvinylacetat beim Erhitzen?
1.3 Technisch wird ein
großer Teil des Polyvinylacetats durch Hydrolyse in
Polyvinylalkohol umgewandelt, wobei das Kettengerüst
erhalten bleibt. Geben Sie für die bei der Hydrolyse
entstehenden Teilchen die Strukturformel bzw. einen
geeigneten Strukturformelausschnitt mit allen bindenden und
nicht-bindenden Elektronenpaaren an.
3. Als chirurgisches Nähmaterial wird ein Kunststoff verwandt, dessen Makromoleküle durch folgenden Formelausschnitt dargestellt werden:
Er wird durch
Enzyme hydrolytisch zu körperunschädlichen Stoffen
abgebaut, wodurch ein späteres Ziehen der Fäden entfällt.
3.1 Klassifizieren Sie diesen Kunststoff nach Aufbau und
nach dem Reaktionstyp seiner Entstehung aus den Monomeren.
3.2 Geben Sie die Strukturformeln der bei der Hydrolyse
dieses Kunststoffs entstehenden Abbauprodukte in
Fischer-Projektion an und benennen Sie diese.
Aufgabe III/1:
1. Mit gleichen Stoffportionen einer
Wasserstoffperoxid-Lösung werden zwei Experimente
durchgeführt:
Versuch A: Die Wasserstoffperoxid-Lösung
wird mit einer Spatelspitze Braunstein (Mangan(IV)-oxid)
versetzt. Außer einer Gasentwicklung ist nichts zu
beobachten.
Versuch B: Die Wasserstoffperoxid-Lösung wird
zu schwefelsaurer Kaliumpermanganat-Lösung gegeben; diese
wird entfärbt und es entsteht eine doppelt so große
Gasportion wie in A.
1.1 Erläutern Sie die
unterschiedliche Rolle, die die eingesetzten
Manganver-bindungen spielen und formulieren Sie für beide
Reaktionen jeweils die Reaktionsgleichung mit
Oxidationszahlen.
1.2 Die in Versuch B ablaufende
Reaktion wird bei der Waschmittelanalyse genutzt zur
Bestimmung des Gehalts an Natriumperborat (NaBO2 * H2O2 * 3
H2O). Dabei werden bei der Titration einer Waschmittelprobe
mit schwefelsaurer Kaliumpermanganat-Lösung der
Konzentration c(MnO4-) = 0,02 mol*l-1 26 ml dieser Lösung
verbraucht.
Berechnen Sie die Stoffmenge n des in der
Probe enthaltenen Natriumperborats in Mol sowie seine Masse.
Geben Sie an, wie man den Endpunkt der Titration feststellt.
2.Wasserstoffperoxid-Lösung kann bei Verwendung
einer Palladium-Elektrode als Sauerstofflieferant in
Brennstoffzellen eingesetzt werden.
Skizzieren und
erläutern Sie den Aufbau einer
Wasserstoff-Sauerstoff-Brennstoffzelle mit
Wasserstoffperoxid-Halbzelle.
Geben Sie die
Elektrodenreaktionen an.
3. Kombiniert man zwei
Wasserstoffperoxid-Halbzellen gleicher Konzentration
miteinander, so erhält man ein elektrochemisches Element mit
der Spannung U = 0 Volt.
3.1 Berechnen Sie das Potential
einer solchen Halbzelle für die
Wasserstoffperoxidkonzentration c(H2O2) = 1 mol*l-1. Führen
Sie die Rechnung für eine Sauerstoffelektrode durch;
benutzen Sie außerdem pH = 7.
3.2 Erläutern Sie, wie man
aus diesem elektrochemischen Element ein
Konzentrationselement erhalten kann, ohne Wasser oder
Wasserstoffperoxid zuzugeben.
Anmerkung zu 3.1: Führen
Sie die Rechnung für eine Sauerstoffelektrode durch,
benutzen Sie außerdem pH=7.
Aufgabe III/2:
1. Seit
1867 wird in einem Verfahren nach A. W. v. Hofmann Methanal
(Formaldehyd) großtechnisch bei 600 °C – 700 °C aus Methanol
hergestellt, wobei Silbernetze als Katalysatoren wirken.
Dabei wird ein Teil des Methanols direkt zu Formaldehyd
dehydriert. Der entstehende Wasserstoff reagiert am
Katalysator mit dem Sauerstoff der Luft.
1.1
Formulieren Sie die Gleichungen der Teilreaktionen und die
Bruttoglei-chung der Gesamtreaktion.
Zeigen Sie, dass
dabei Methanol oxidiert wird.
1.2 Begründen Sie, wie man
die Ausbeute an Formaldehyd vergrößern kann.
1.3
Für die Reaktion von 1 mol Methanol mit Sauerstoff zu
Formaldehyd und Wasser gilt: ΔHR0= – 159 kJ*mol-1.
Berechnen Sie die molare Standardbildungsenthalpie von
Wasser mit Hilfe der gegebenen Werte (siehe Tabelle unten).
1.4 Für die Dehydrierung von 1 mol Methanol zu Methanal und
Wasserstoff ist die Reaktionsenthalpie ΔHR0 = + 85 kJ.
Zeigen Sie, daß die Reaktion bei 600 °C exergonisch ist.
(ΔHR0 , ΔGR0 und S0 werden als temperaturunabhängig
angenommen.)
2. Methanal läßt sich zu Methansäure oxidieren.
Welcher der beiden Stoffe hat die höhere Siedetemperatur?
Begründen Sie Ihre Aussage.
3. Ameisensäure ist Bestandteil von gebräuchlichen
Entkalkungsmitteln. Formulieren Sie eine
Reaktionsgleichung für die Umsetzung der Ameisensäure mit
dem Kalk. Begründen Sie, warum Ameisensäure den Kalk
auflöst.
| CH3OH | HCHO | H2O | O2 | H2 | |
| S0 in J*mol-1*K-1 | +240 | +219 | +189 | +205 | +131 |
| ΔHf0 in kJ . mol–1 | -201 | -116 | - | - | - |
Lösung(BW90)