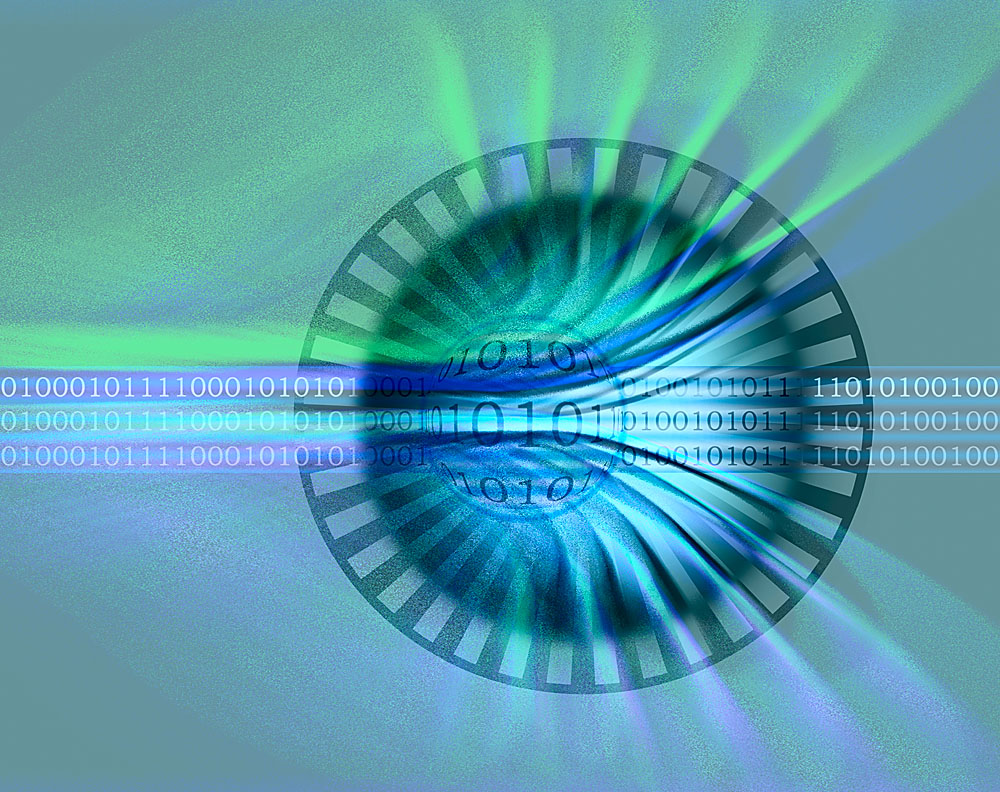Aufgabe 13
Aufgabe I:
1 In einem Forschungslabor wird zu Experimentierzwecken
ein Po-210-Präparat (α-Strahler, Halbwertzeit = 138,38
Tage) verwendet.
Die Masse der Stoffportion beträgt mo.
1.1 Berechnen Sie, wie lange mit diesem Präparat
experimentiert werden kann, wenn für die Versuche eine
Mindestmasse von 0,02 . mo nötig ist!
Die Rechengang Muss
klar ersichtlich sein.
1.2 Eine Mischung aus Be-9 und
Po-210 dient als Neutronenquelle.
Formulieren Sie für die
zugrundeliegenden Kernreaktionen die Gleichungen!
1.3
Beschreiben Sie ein Experiment, mit dem man die
Teilchenstrahlung des Po-210-Präparats sichtbar machen kann!
2 Sowohl Propen als auch Methylpropen reagieren im
Dunkeln und bei Raumtemperatur mit Hydrogenbromid
(Bromwasserstoff).
2.1 Formulieren und erläutern Sie die
Schritte der Reaktion mit Propen, die zur Bildung des
Hauptproduktes führen, und benennen Sie dieses!
2.2
Begründen Sie, weshalb Methylpropen rascher reagiert als
Propen!
2.3 Hydrogenbromid soll in Gegenwart von
Chlorid-Ionen mit Propen reagieren.
Geben Sie den Namen
und die Strukturformel des Produktes an, das zusätzlich zu
dem Reaktionsprodukt aus Nummer 2.1 in nennenswertem Umfang
entsteht, und begründen Sie dessen Bildung!
3
Teststreifen für Harnzucker reagieren spezifisch auf
β-D-Glucose mit Grünfärbung. Die Glucose-Moleküle werden
dabei unter dem Einfluss des Enzyms Glucoseoxidase am ersten
C-Atom oxidiert.
3.1 Erläutern Sie mit Hilfe einer
Modellvorstellung die Grundlagen der Substratspezifität
eines Enzyms!
3.2 Saccharoselösung wird mit Salzsäure
gekocht. Die abgekühlte Lösung wird neutralisiert und mit
dem Teststreifen untersucht.
Geben Sie das Testergebnis
an, und erklären Sie es unter Mitverwendung von
Strukturformelgleichungen!
3.3 Das gemäß Nummer 3
entstehende Oxidationsprodukt der Glucose bildet einen
intramolekularen Ester, wobei ein Sechsring ausgebildet
wird.
Zeichnen Sie die Strukturformel dieses Esters!
4 p-Nitroanilin bildet blassgelbe Kristalle; bei Zugabe von
Salzsäure entsteht eine farblose Lösung.
4.1 Erklären Sie
den beschriebenen Farbwechsel unter Mitverwendung von
Strukturformeln!
4.2 Formulieren und benennen Sie die
Einzelschritte der Bildung eines Azofarbstoffes aus Anilin
(Aminobenzol) und p-Nitroanilin! Alle sonst noch benötigten
Reagenzien stehen zur Verfügung.
4.3 Die Azokupplung
ist eine elektrophile aromatische Substitution.
Begründen
Sie den Einfluss der Nitrogruppe im Diazonium-Ion auf die
Geschwindigkeit der Kupplungsreaktion!
Aufgabe II:
1 Der Gehalt an oxidierbaren organischen Schmutzstoffen
im Wasser kann durch den Verbrauch an Kaliumpermanganat
abgeschätzt werden. Hierzu werden 100,0 ml einer
Wasserprobe mit Schwefelsäure und 15,0 ml
Kaliumpermanganatlösung der Konzentration c
(Kaliumpermanganat)
= 0,002 mol/l erhitzt.
Dann
werden 15,0 ml Oxalsäurelösung der Konzentration c
(Oxalsäure)= 0,005 mol/l zugefügt.
Ein Teil der
Oxalsäure wird dabei vom verbliebenen Kaliumpermanganat zu
Kohlenstoffdioxid oxidiert.
Die restliche Menge an
Oxalsäure wird schließlich durch Titration mit
Kaliumpermanganatlösung der Konzentration c
(Kaliumpermanganat) = 0,002 mol/l bestimmt; von der
Kaliumpermanganatlösung werden dabei 5,0 ml verbraucht.
1.1 Formulieren Sie die Gleichung für die Reaktion von
Kaliumpermanganat mit Oxalsäure!
1.2 Berechnen Sie den
Kaliumpermanganatverbrauch der Wasserprobe in Milligramm
Kaliumpermanganat pro Liter Wasser!
Der Gang der
Berechnung Muss klar ersichtlich sein.
2
Carbonylverbindungen können Additionsreaktionen eingehen.
2.1 Formulieren Sie die Summengleichung für die Reaktion von
Trichlorethanal mit Ammoniak!
2.2 Begründen Sie, weshalb
sich die Additionsgeschwindigkeit von Ammoniak in der
Reihenfolge Ethanal, Methanal, Trichlorethanal erhöht!
2.3 Trichlorethansäure, die durch Oxidation von
Trichlorethanal entstehen kann, besitzt einen pKs-Wert von
0,7.
2.3.1 Beschreiben Sie eine experimentelle Methode,
mit der man den pKs-Wert
einer schwachen Säure bestimmen kann!
2.3.2 Ordnen Sie
Ethansäure, Methansäure und Trichlorethansäure nach
steigen-dem pKs-Wert, und begründen Sie die Reihenfolge!
3 Die Moleküle eines synthetischen
Fettes werden durch die Formel C3H5(C16H31O2)3 beschrieben.
3.1 Geben Sie an, welchen Aggregatzustand dieses Fett bei
Zimmertemperatur hat, und begründen Sie Ihre Aussage!
3.2 Das gegebene Fett wird längere Zeit mit Kalilauge
gekocht.
Formulieren Sie die Gleichung für die
eintretende Reaktion!
3.3 Die Verseifungszahl gibt die
Masse Kaliumhydroxid in Milligramm an, die zur Hydrolyse von
1 g Fett benötigt wird.
Erläutern Sie, worauf der
Unterschied in den Verseifungszahlen von Kokosfett
(Verseifungszahl ca. 250) und Rinderfett (Verseifungszahl
ca. 190) zurückzuführen ist!
4 Das beim biologischen
Fettabbau entstehende Glycerin wird zu Glycerinaldehyd
oxidiert.
4.1 Nennen Sie die Hauptabschnitte des
biologischen Abbaus von Glycerinaldehyd zu Kohlenstoffdioxid
und Wasser!
4.2 Erläutern Sie den
Hauptabschnitt des Abbauweges, bei dem am meisten
Adenosintriphosphat entsteht!
Aufgabe III:
1 Harnstoff, ein Endprodukt des Eiweißstoffwechsels beim Menschen, wurde im Jahre 1828 von Friedrich Wöhler erstmals synthetisiert. Die Strukturformel von Harnstoff, dessen Molekül aus Kohlenstoff-, Wasserstoff-, Sauerstoff- und Stickstoff-Atomen aufgebaut ist, soll ermittelt werden.
1.1 1,60 g
Harnstoff werden vollständig oxidiert. Unter den Produkten
sind 0,96 g Wasser und 1,17 g Kohlenstoffdioxid. In einem
weiteren Analyseschritt, ebenfalls ausgehend von 1,60 g
Harnstoff, wird der Stickstoffanteil in 0,91 g Ammoniak
übergeführt.
Berechnen Sie das Atomzahlenverhältnis im Harnstoffmolekül!
Der
Gang der Berechnung muss klar ersichtlich sein.
1.2 Zur
Bestimmung der molaren Masse wird aus 1,80 g Harnstoff eine
wässrige Lösung mit einem Volumen von 100 ml bereitet. Die
Messung des osmotischen Druckes ergibt bei 293 K einen Wert
von 7,3 * 105 Pa.
Berechnen Sie die molare Masse von Harnstoff, und geben Sie
dessen Summenformel an! Der Gang der Berechnung muss klar
ersichtlich sein.
1.3 Harnstoff ist das Diamid der Kohlensäure.
Leiten Sie aus dieser Angabe und der Summenformel die
Strukturformel von Harnstoff ab!
2 Die Hydrolyse von Harnstoff zu Ammoniak und
Kohlenstoffdioxid wird durch das Enzym Urease katalysiert.
Urease eignet sich besonders gut für Untersuchungen zur
Enzymaktivität, da die Produkte der Harnstoffspaltung
mit Wasser reagieren, wobei Ionen entstehen, die eine Zunahme
der elektrischen Leitfähigkeit der Lösung bedingen.
In
einer Versuchsreihe werden gleiche Volumina unterschiedlich
konzentrierter Harnstofflösungen mit der jeweils gleichen
Stoffmenge Urease vermischt. Nach jeweils gleicher
Versuchsdauer wird die Leitfähigkeit jeder Lösung bestimmt
und in Abhängigkeit von der Harnstoffkonzentration
graphisch dargestellt.
Die
Kurve steigt mit zunehmender Harnstoffkonzentration zunächst
an und fällt nach Erreichen eines Maximums ab.
2.1
Formulieren Sie die Gleichungen für die Hydrolyse von
Harnstoff und die Reaktion der Produkte mit Wasser!
2.2
Erklären Sie unter Verwendung von Fachbegriffen den
beschriebenen Kurvenverlauf!
2.3 Mit
einer Harnstofflösung bestimmter Konzentration wird die
Wirkung des Enzyms Urease in Abhängigkeit von der Temperatur
ermittelt.
Tragen Sie in einem Diagramm den Substratumsatz pro
Zeiteinheit (Umsatzrate) gegen die Temperatur auf, und
erklären Sie den Verlauf dieses Graphen!
3 Aminosäuren, die Bausteine der Proteine, existieren
auf der Erde seit drei Milliarden Jahren und wurden auch in
Meteoriten nachgewiesen.
3.1 Eine
stark angesäuerte, konzentrierte wässrige Lösung der
Aminosäure Tyrosin wird langsam stark alkalisch gemacht.
3.1.1 Schildern Sie die
Beobachtungen bei diesem Versuch, und erklären Sie die
beobachteten Phänomene!
3.1.2 Für Tyrosin gilt: pKs (– COOH) = 2,20;
pKs (– NH3+) = 9,11; pKs(– OH) = 10,07.
Leiten Sie aus den gegebenen pKs-Werten die
Reihenfolge der Protolysen ab, und formulieren Sie die
zugehörigen Reaktionsgleichungen!
3.2 Aus den
drei Aminosäuren
Glycin (Aminoethansäure; Symbol:
Gly),
Alanin (2-Aminopropansäure; Symbol;
Ala) und
Valin (2-Amino-3-methylbutansäure;
Symbol: Val)
wird das Tripeptid Gly-Ala-Val
aufgebaut.
3.2.1 Stellen Sie die
Strukturformel für das unter Nummer 3.2 genannte Tripeptid
auf, und heben Sie darin mit Farbe die Bestandteile der
Peptidbindungen hervor!
3.2.2 Erläutern Sie unter
Mitverwendung einer Skizze die Raumstruktur und die
Bindungsverhältnisse in der Peptidgruppe!
4 Die Xanthoproteinreaktion von Eiweißstoffen mit
konzentrierter Salpetersäure tritt ein, wenn in diesen
aromatische Aminosäuren, z. B. Tyrosin, gebunden sind.
Hierbei erfolgt eine Nitrierung des aromatischen
Ringsystems.
Stellen Sie den Mechanismus der Nitrierung von Phenol
unter Mitverwendung von Strukturformelgleichungen bis zu
den bevorzugten Monosubstitutionsprodukten dar!
Aufgabe IV:
1 Chromat ist ein Umweltgift, das auch den menschlichen
Organismus stark schädigt. Deshalb ist seine quantitative
Bestimmung sehr wichtig; diese erfolgt (vereinfacht) in
folgenden Schritten:
50,0 ml der chromathaltigen Lösung werden mit Schwefelsäure
angesäuert. Dabei geht das Chromat (CrO42–,
gelb) in Dichromat (Cr2O72–,
orange) über. Die erhaltene Dichromatlösung wird mit einem
Überschuss Kaliumiodid versetzt. In einer Redoxreaktion
werden Chrom (III)-Ionen (grün) und Iod gebildet. Das
freigesetzte Iod wird maßanalytisch mit
Natriumthiosulfatlösung der Konzentration c
(Natriumthiosulfat) = 0,1 mol/l bestimmt. Von der Maßlösung
werden bis zum Äquivalenzpunkt 15,0 ml verbraucht.
1.1 Stellen
Sie für die drei beschriebenen Reaktionen die
Ionengleichungen auf!
1.2
Berechnen Sie die Stoffmengenkonzentration der Chromat-Ionen
in der Lösung! Der Gang der Berechnung muss klar ersichtlich
sein.
2 Dichromat kann in der analytischen Chemie auch bei
der Identifizierung organischer Verbindungen herangezogen
werden. In einer Verbindung liegt das Atomzahlenverhältnis
N(C) : N(H) : N(O) = 1 : 2 : 1 vor; die molare Masse dieses
Stoffes beträgt 90 g/mol. Untersuchungen zur
Strukturermittlung liefern folgende Ergebnisse:
– nach Reaktion mit schwefelsaurer
Kaliumdichromatlösung Grünfärbung,
– positiver Verlauf der Iodoformprobe und
– Rotfärbung von Lackmuslösung.
2.1
Erläutern Sie, welche Schlüsse auf die Molekülstruktur aus
obigen Angaben gezogen werden können, und zeichnen Sie
mögliche Strukturformeln!
2.2
Beschreiben Sie ein physikalisches Verfahren, mit dem man
die unter Nummer 2.1 gesuchten Verbindungen unterscheiden
kann!
3 Der in Vorderasien heimische Strauch Astragalus gummifer scheidet bei Verletzung eine zähflüssige Masse aus, die als Tragant u. a. zum Verdicken von Speiseeis verwendet wird. Tragant ist ein Gemisch aus zwei Polysacchariden. Als monomerer Baustein lässt sich die D-Xylose nachweisen
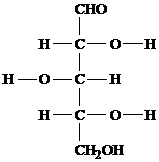
3.1
Legen Sie dar, welche Informationen die Symbole D und (+)
enthalten!
Formulieren Sie die Fischer-Projektionsformel
der L-Xylose!
3.2
Zeichnen Sie eine Strukturformel der α-D-(+)-Xylose
in der Sechsringform (als Xylopyranose)!
3.3 Wird
die frisch bereitete wässrige Lösung von α-D-(+)-Xylose
im Polarimeter untersucht, so beobachtet man eine Änderung
des Drehwinkels.
Benennen und erklären Sie diese Erscheinung!!
3.4 Mit
D-Xylose verläuft die Silberspiegelprobe positiv.
Beschreiben Sie die
Durchführung dieser Nachweisreaktion, und
formulieren Sie die Redoxgleichung!
3.5
D-Xylose ist auch Bestandteil des Polysaccharids Xylan, das
neben der Cellulose als Gerüststoff in der pflanzlichen
Zellwand vorkommt.
In
Xylan sind D-Xylopyranose-Reste β-(1 - 4)-glykosidisch
miteinander verknüpft.
Zeichnen Sie einen charakteristischen
Strukturformelausschnitt von Xylan!
4Kautschuk wird aus dem Milchsaft verschiedener
tropischer Bäume gewonnen. Er hat als Rohstoff für Gummi
große wirtschaftliche Bedeutung (Vulkanisation) und diente
als Vorbild für die Entwicklung von Synthese-Kautschuk.
4.1 Geben
Sie für den Naturkautschuk und für das Vulkanisationsprodukt
Gummi jeweils einen charakteristischen
Strukturformelausschnitt an!
4.2
Vergleichen Sie die mechanischen Eigenschaften von
Naturkautschuk und Gummi, und begründen Sie die
Unterschiede!
4.3 Durch
Polymerisation von 2-Chlor-1,3-butadien entsteht der
synthetische Kautschuk Neopren.
Stellen Sie einen Mechanismus für diese Polyreaktion
mit Strukturformeln dar!
Lösung(BY93