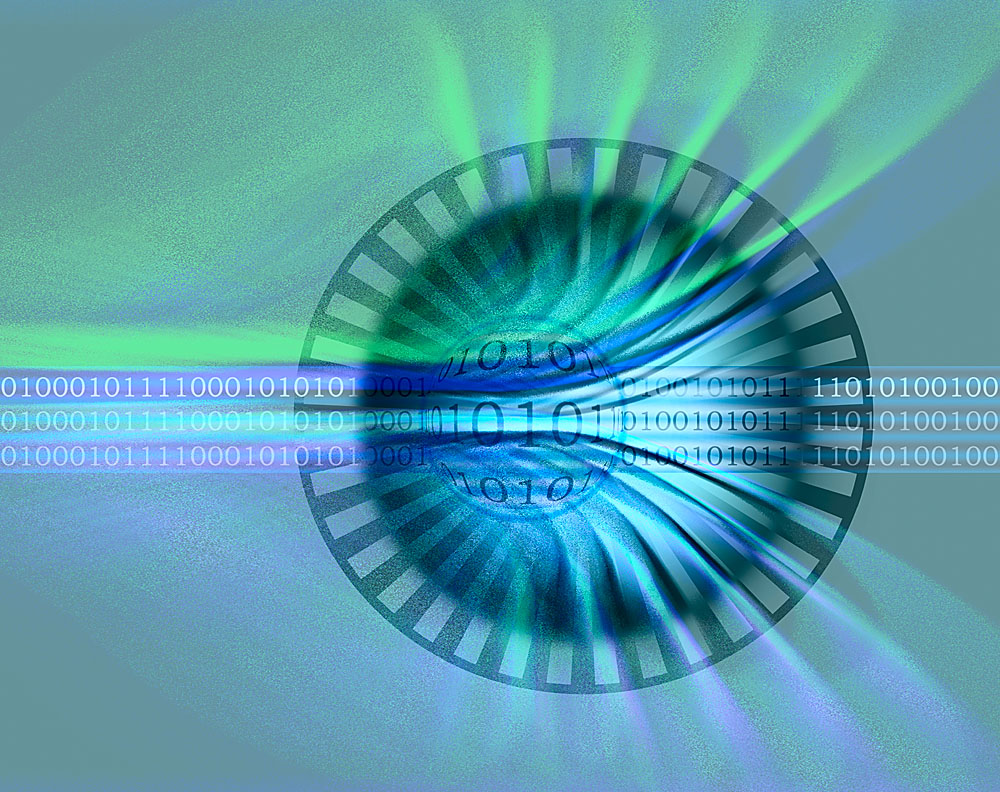Aufgabe 4
Aufgabe I/1:
Aus dem bei der Entschwefelung von Erdöl anfallenden Schwefelwasserstoff erhält man im CLAUS-Prozess besonders reinen Schwefel. Dabei wird im ersten Schritt ein Teil des Schwefelwasserstoffs mit Luftsauerstoff zu Schwefeldioxid verbrannt. Dieses wird im zweiten Schritt mit dem restlichen Schwefelwasserstoff am Katalysator umgesetzt.
1: Geben Sie für die beiden Reaktionsschritte zur Schwefelgewinnung im CLAUS-Prozess die Reaktionsgleichungen mit den Oxidationszahlen an.
2: Der so gewonnene Schwefel wird zur Schwefelsäuregewinnung zu Schwefeldioxid verbrannt. Dieses wird in einem Hordenofen, in dem der Katalysator in vier Schichten (Horden) angeordnet ist, mit Luftsauerstoff weiteroxidiert. Das 450 °C heiße Gasgemisch reagiert dabei an jeder Horde, wobei sich seine Temperatur erhöht. Vor Erreichen der nächsten Horde wird es wieder auf 450 °C abgekühlt.
2.1 Formulieren Sie die Reaktionsgleichung für die am Katalysator ablaufende Gleichgewichtsreaktion und wenden Sie darauf das Massenwirkungsgesetz an. Erklären Sie, warum das Gasgemisch vor jeder Horde auf 450 °C abgekühlt wird, eine stärkere Abkühlung aber nicht sinnvoll ist.
2.2 Berechnen Sie die Masse der Stoffportion Schwefel, die bei vollständiger Umsetzung benötigt wird, um bei 450 °C 100 Liter Schwefeltrioxid-Gas zu erhalten.
Das molare Volumen beträgt bei diesen Bedingungen 59,3 l*mol-1.
3: Schwefelsäureabfälle können entsorgt werden, indem die darin enthaltene Schwefelsäure bei 1000 °C in Sauerstoff, Wasser und Schwefeldioxid zersetzt wird. Das schädliche Gas Schwefeldioxid wird mit einer
wässrigen Ammoniaklösung ausgewaschen. Dabei entsteht zunächst Ammoniumsulfit, das mit Luftsauerstoff zu Ammoniumsulfat oxidiert wird.
Formulieren Sie die entsprechenden Reaktionsgleichungen.
4: Eine
wässrige Lösung mit dem Volumen V = 250 ml enthält eine Stoffportion Ammoniumsulfat mit der Masse m = 1,65 g.
Berechnen Sie die Stoffmengenkonzentration c der Ammonium-Ionen und daraus den pH-Wert der Lösung.
Aufgabe I/2:
Ein Oligopeptid ist aus vier Aminosäuren in
folgender Sequenz aufgebaut:
Alanin-Glycin-Cystein-Glutaminsäure
Die Carboxylgruppe
des Alanins ist an der Peptidbindung beteiligt.
1.1 Zeichnen Sie die Strukturformeln der vier
Aminosäuren mit bindenden und nichtbindenden
Elektronenpaaren.
1.2 Welche dieser Aminosäuren sind
optisch aktiv? Geben Sie eine Begründung.
1.3
Zeichnen Sie eine Strukturformel des Oligopeptids.
1.4
Die an einer Peptidgruppe beteiligten Atome liegen in einer
Ebene. Geben Sie dafür eine Erklärung.
2: Das
Oligopeptid wird vollständig hydrolysiert. Wie lässt sich
diese Hydrolyse durchführen? Beschreiben Sie ausführlich,
wie die im Hydrolysat vorliegenden Aminosäuren getrennt und
identifiziert werden können.
3: Eine wässrige Lösung von
Alanin besitzt im sauren Bereich Pufferwirkung. Geben Sie
die Strukturformel der unter dieser Bedingung vorliegenden
Alaninteilchen an und erklären Sie die Puffereigenschaft der
Lösung.
4: Butansäure ist bei Zimmertemperatur flüssig,
während sich Alanin als kristalline Substanz nicht
unzersetzt schmelzen lässt. Geben Sie dafür eine Erklärung.
Aufgabe II/1:
1. Bei der Synthese von Kunststoffen kommen unter
anderem folgende Monomere zum Einsatz:
a) Chlorethen
(Vinylchlorid)
b) Phenylethen (Styrol)
c)
1,6-Diaminohexan (Hexamethylendiamin)
d)
1,2,3-Propantriol (Glycerin)
e) Butandisäure
(Bernsteinsäure)
1.1 Geben Sie für die Stoffe a bis e jeweils eine
Strukturfomel mit bindenden und nichtbindenden
Elektronenpaaren an.
1.2 Geben Sie sinnvolle
Formelausschnitte der Makromoleküle an, die aus den
Molekülen der Stoffe a bis e gebildet werden können (ohne
Mischpolymerisate und Mischpolykondensate).
1.3
Beschreiben Sie das experimentelle Vorgehen für die
Herstellung eines Kunststoffes ausgehend von Phenylethen und
formulieren Sie den der Reaktion zugrunde liegenden
Mechanismus.
2 Für Verpackungsmaterial sind
Kunststoffe erwünscht, die nach Anwendung verschiedener
Recycling-Verfahren wiederverwertet werden können. Diese
Verfahren beruhen zum Beispiel auf Umschmelzprozessen oder
auf hydrolytischer Spaltung.
2.1 Entscheiden Sie,
welche der Kunststoffe aus Aufgabenteil 1.2 durch
Umschmelzen, welche durch Hydrolyse der Wiederverwertung
zugeführt werden können, und begründen Sie Ihre
Entscheidung.
2.2 Neben dem Recycling spielt auch
die Verbrennung von Kunststoffen bei der Abfallbeseitigung
eine Rolle.
Nennen Sie einige Schadstoffe, die bei der
Verbrennung der Kunststoffe aus Aufgabenteil 1.2 entstehen
können.
Formulieren Sie für die Verbrennung von
Chlorethen, stellvertretend für Polychlorethen (PVC), eine
Reaktionsgleichung.
Beschreiben Sie für zwei bei der
Verbrennung von PVC entstehende Produkte einen geeigneten
experimentellen Nachweis.
Aufgabe II/2:
Benzol und Pyridin sind flüssige aromatische
Verbindungen, deren Moleküle strukturell verwandt sind: Im
Pyridinmolekül (Summenformel C5H5N) ist eine CH-Gruppe des
Benzolmoleküls durch ein Stickstoffatom ersetzt.
1:
Zeichnen Sie die Strukturformel des Pyridinmoleküls und
beschreiben Sie seinen Aufbau mit Hilfe des Orbitalmodells.
2: Pyridin ist im Gegensatz zu Benzol in Wasser gut
löslich. Geben Sie dafür eine Erklärung.
3: Leitet man
Chlorwasserstoff in Pyridin ein, so entsteht eine Lösung,
die den elektrischen Strom leitet. Im Gegensatz dazu
entsteht beim Einleiten von Chlorwasserstoff in Benzol kein
Elektrolyt.
Erklären Sie diesen Sachverhalt. Formulieren
Sie eine Reaktionsgleichung mit Strukturformel.
4: Bei
der Nitrierung mit einem Gemisch aus konzentrierter
Salpetersäure und konzentrierter Schwefelsäure
(„Nitriersäure“) reagiert Pyridin wesentlich langsamer als
Benzol.
4.1: Erklären Sie mit Hilfe mesomerer
Grenzformeln des Pyridinmoleküls, warum die elektrophile
Substitution bei Pyridin erschwert ist. Geben Sie an, welche
Wasserstoffatome des Pyridinmoleküls bevorzugt substituiert
werden.
4.2: Erläutern Sie die Entstehung des
elektrophilen Teilchens in der Nitriersäure und formulieren
Sie den Reaktionsmechanismus der Nitrierung von Benzol.
4.3: Bei der Bromierung von Nitrobenzol können
verschiedene monobromierte Produkte entstehen. Eines davon
wird bevorzugt gebildet. Geben Sie dieses an und begründen
Sie Ihre Entscheidung.
Aufgabe III/1:
1. Im Labor kann Brom nach verschiedenen Verfahren
gewonnen werden.
a) Durch Einleitung von Chlor in eine
wässrige Lösung von Kaliumbromid.
b) Durch Reaktion einer
sauren Kaliumbromidlösung mit Mangandioxid (Braunstein).
c) Durch Elektrolyse einer neutralen Kaliumbromidlösung der
Konzentration c = 0,1 mol*l-1.
1.1:
Formulieren Sie für a und b die Reaktionsgleichung unter
Angabe sämtlicher Oxidationszahlen.
1.2: Formulieren
Sie für c die an den Elektroden ablaufenden Reaktionen und
berechnen Sie die Zersetzungsspannung ohne Berücksichtigung
von Überspannungen.
2: Das Normalpotential des
Redoxpaares Bromid/Brom soll gemessen werden.
2.1:
Erläutern Sie das Verfahren anhand einer beschrifteten
Skizze.
2.2: In die Bromid/Brom-Halbzelle gibt man
etwas Silbernitratlösung.
Wie wird dadurch das Potential
der Zelle beeinflusst? Geben Sie eine Begründung.
3: Eine Kaliumbromidlösung wird mit einer angesäuerten
Kaliumdichromat-lösung versetzt. Kann dabei Brom entstehen,
falls das Reaktionsgemisch einen pH = 2 besitzt und die
folgenden Konzentrationen vorliegen:
c(Cr2O72-) = 1 mol*l-1, c(Cr3+) = 0,001 mol*l-1 und c(KBr) = 1 mol*l-1?
Begründen Sie anhand einer Berechnung.
4: Brom
kann durch Reaktion mit einer Natriumsulfitlösung beseitigt
werden.
Formulieren Sie die Reaktionsgleichung
Aufgabe III/2:
1 Im Hinblick auf einen ökonomischen Einsatz
verschiedener Brennstoffe bietet sich ein Vergleich ihrer
oberen Heizwerte H* an. Man versteht darunter die
Wärmemenge, die bei vollständiger Verbrennung einer
Stoffportion der Masse m = 1 kg des jeweiligen Stoffes frei
wird, wobei flüssiges Wasser als eines der Reaktionsprodukte
zugrundegelegt wird.
1.1 Geben Sie jeweils die
Reaktionsgleichung für die vollständige Verbrennung von
Methan und Ethanol an.
1.2 Berechnen Sie unter Verwendung
der angegebenen Tabellenwerte für jede der Verbrennungen die
Reaktionsenthalpie sowie den oberen Heizwert H* eines jeden
der beiden Brennstoffe.
1.3 Beschreiben Sie unter
Zuhilfenahme einer beschrifteten Skizze die experimentelle
Bestimmung des Heizwertes im Verbrennungskalorimeter. 4 VP
1.4 In einem Verbrennungskalorimeter der Wärmekapazität CKal
= 60 J*K-1, gefüllt mit 500 g Wasser (cp = 4,18 J*g-1*
K-1), wird eine Stoffportion Methan der Masse m = 0,1 g
verbrannt. Berechnen Sie unter Berücksichtigung des oberen
Heizwertes von Methan die zu erwartende Temperaturerhöhung
im Kalorimeter.
2 Eine andere Art der Brennstoffnutzung
stellt die Gewinnung elektrischer Energie in
Brennstoffzellen dar.
2.1 Skizzieren Sie den Aufbau der
Knallgaszellen als Beispiel einer Brennstoffzelle und
erläutern Sie die Vorgänge an den Elektroden.
2.2
Berechnen Sie für die in der Knallgaszelle ablaufende
Gesamtreaktion mit Hilfe der angegebenen Tabellenwerte die
freie Reaktionsenthalpie bei 25 °C.
2.3 Zeigen Sie am
Beispiel der Knallgasreaktion, daß die Betrachtung der
freien Reaktionsenthalpie für die Begründung eines spontanen
Reaktionsablaufs nicht ausreicht.
| CH4 | C2H5OH | CO2 | H2O(g) | H2O(l) | O2 | H2 | |
| ΔHf in kJ*mol-1 | -75 | -278 | -393 | -242 | -286 | ||
| S in J*mol-1*K-1 | 189 | 70 | 205 | 131 |
Lösung(BW92)